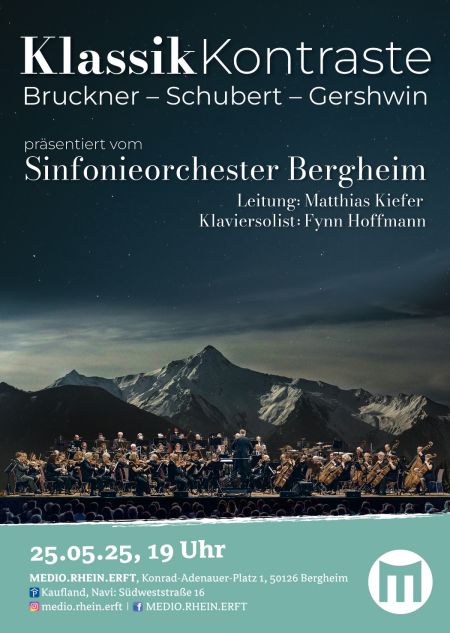Dmitri Schostakowitsch
Dmitri Schostakowitsch, 1906 in St. Petersburg geboren, lernt bei seiner Mutter, einer Pianistin, Klavier spielen und hält aufmerksam sein Ohr an die Wand, wenn die Nachbarn Quartett spielen. Er hat das absolute Gehör, ein ausgezeichnetes Gedächtnis, phantasiert stundenlang am Klavier und versucht, seine Musik aufzuschreiben.
1917 wird er auf der Straße Zeuge, wie ein junger Arbeiter erschossen wird. Danach schreibt er einen „Trauermarsch für die Opfer der Revolution“. Das Mitgefühl mit den geknechteten Opfern jeder Barbarei wird später zum Grundklang seiner Musik werden. Nach dem Zusammenbruch des Zarenreichs herrscht unvorstellbarer Hunger und Chaos.
Der 13jährige wird ins Petrograder Konservatorium aufgenommen und Schüler von Leonid Nikolajew, Klavier und Maximilian Steinberg, Komposition. Die Räume sind nicht geheizt, aber man musiziert unverdrossen in Mantel und Handschuhen und hört viel Musik. Dmitri spielt Bach, Beethoven, Schumann, Liszt und Chopin und lernt durch seine Mitschülerin Marija Judina auch Krenek, Hindemith und Bartok kennen. Daneben besucht er so viele Konzerte und Orchesterproben wie möglich und begeistert sich vor allem für Mahler und für Alban Berg, der nach Leningrad kommt, um sich seinen Wozzeck im Marinski-Theater anzuhören. Der Direktor Glasunow verschafft Dmitri ein Stipendium, das ihn vor dem Verhungern bewahrt. Dafür kriegt er von Vater Schostakowitsch illegalen Alkohol.
1922 stirbt der Vater, Dmitri bekommt eine Tuberkulose. Die Mutter verkauft den Flügel und schickt den Sohn auf die Krim zur Erholung. 1923 schließt er das Klavierstudium ab, muss aber das Konservatorium verlassen. Er arbeitet nun als Pianist im Stummfilmtheater. Währenddessen schreibt er seine 1. Sinfonie, um sie als Diplomarbeit einreichen zu können. Der „Geniestreich“ wird am 12.5. in der Philharmonie uraufgeführt, denn zum Glück ist gerade wegen der Strauss-Oper Salome eine große Blechbläser-Besetzung da. Der große Erfolg spricht sich herum. 1927 wird sie z.B. in Berlin von Bruno Walter aufgeführt. Alban Berg hört sie und schreibt dem jungen Komponisten einen Gratulationsbrief. Die Sinfonie zeigt eine ganz erstaunliche Beherrschung der Form, dabei ausgeprägt individuellen Stil und originelle, meisterliche Instrumentierung.
Trotz der schweren Zeiten blüht in Leningrad das kulturelle Leben. Abstrakte Kunst ist in und auch in der Musik sind Experimente gefragt. Schostakowitsch schreibt die tragisch-satirische Oper „Die Nase“ nach Nikolaj Gogol, den er sehr bewundert. Dabei kombiniert er eingängige Melodien mit absurder Harmonisierung oder unerwarteter Instrumentierung. Aber er besteht darauf, dass das ernste Musik und eine tragische Geschichte ist. „Heute spazieren so viele Nasen herum, dass man sich nur wundern kann“, sagt er später. Während der Arbeit daran wohnt er beim Theaterchef Meyerhold, einem überzeugten Kommunisten (1940 hingerichtet). Mit der 2. und 3. Sinfonie kann Schostakowitsch an den Erfolg der ersten nicht anschließen. Daher nimmt er alle Aufträge an. Er schreibt Film- und Ballettmusiken.
Im „goldenen Zeitalter“ von 1929 geht es um sowjetische Fußballspieler in der fremden kapitalistischen Welt. Dmitri wehrt sich erfolglos gegen das flache Libretto, aber die Musik findet großen Anklang. Das nächste Ballett „Der Bolzen“, das in einer Fabrikhalle spielt, wird dagegen ein Fiasko. Gleichzeitig arbeitet er fieberhaft an seiner Oper „Lady Macbeth von Mzensk“, bei der er anders als der Autor Nikolaj Leskow Mitgefühl mit der Mörderin zeigt.
Weil Stalin gerade einige Kontrollgremien plötzlich aufgelöst hat, keimt nun die Hoffnung auf künstlerische Freiheit und frischen Wind auf. Die Oper wird 83mal in Leningrad und 97mal in Moskau stürmisch gefeiert und bringt es auch im Ausland zu 36 Aufführungen. Auch das Ballett „Der helle Bach“ ist beim Publikum beliebt, wird aber von der Kritik verrissen. Denn inzwischen hat sich der politische Wind gedreht.
Stalin besucht am 17. Januar 1936 eine Moskauer Aufführung der Lady Macbeth. Danach erscheint in der Prawda ein Artikel „Wirrwarr statt Musik“. „Das Publikum wird von Anfang an mit absichtlich disharmonischen, chaotischen Tönen überschüttet, weil diese generierte, grelle und neurasthenische Musik der bürgerlichen Hörerschaft schmeichelt. Dieses Spiel kann aber böse enden.“ Oper und Ballett verschwinden von den Spielplänen und Schostakowitsch wird für den Rest seines Lebens die Angst nicht mehr los. Das Denunziantentum blüht. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir durchgemacht haben - jede Nacht zu lauschen und zu warten, ob sie an der Tür pochen, ob ein Auto vor der Tür anhält“, schreibt der Geiger David Oistrach. In Schostakowitschs Musik ist nun das Pochen, das Niederknüppeln und der erzwungene Jubel in jedem Werk zu hören. In der Sowjetunion wird das unterschwellige Programm, trotz verschleiernder Worte auch von Schostakowitsch selbst, sehr gut verstanden. Im Ausland glaubt man dagegen erschreckend lange der offiziellen Propaganda. Selbst der von den Nazis verfolgte Lion Feuchtwanger preist die Genialität Stalins und stellt fest, dass die Moskauer Schauprozesse notwendig für die demokratische Entwicklung seien. Dabei waren durch die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft schon Millionen Menschen an Hunger gestorben (Holodomor in der Ukraine) und Tausende in Lagern verschwunden oder ermordet worden. Seine 4. Sinfonie zieht Schostakowitsch daher schon während der Proben zurück. Während des Krieges lockert sich der Druck etwas, weil man alles auf die faschistische Bedrohung hin deuten kann. Das kippt aber bereits 1948. Schostakowitsch wird vom „Nationalhelden“ plötzlich als „Formalist“ zum Volksfeind. „Man schlägt dich, erlaubt dir aber nicht, dich zu wehren. Verbeuge dich und bedanke dich!“ (Schostakowitsch nach S. Wolkow). Ab 1949 stellt Levon Atowmjan aus den geächteten Balletten und Filmmusiken „unverfängliche“ populäre Tänze zu mehreren Suiten zusammen.
Die erste Ballett-Suite können Sie heute hören. Es ist mitreißende, witzig-ironische Musik, genial instrumentiert. In der Romanze hören Sie die Oboe als berührende menschliche Stimme; es gibt eine Art „Pizzicato-Polka“, in der die Streicher ihre Instrumente zupfen, die Bassgruppe lässt oft an russische Volksmusik denken. Die Bläser ironisieren das Ganze durch grelle Klangfarben und überraschende harmonische Wendungen. Diese Mut machenden Gute-Laune-Ohrwürmer fordern uns auf:
„Lass Dich nicht unterkriegen! Hör gut zu und guck nicht weg!“
„Sei ein Mensch!“