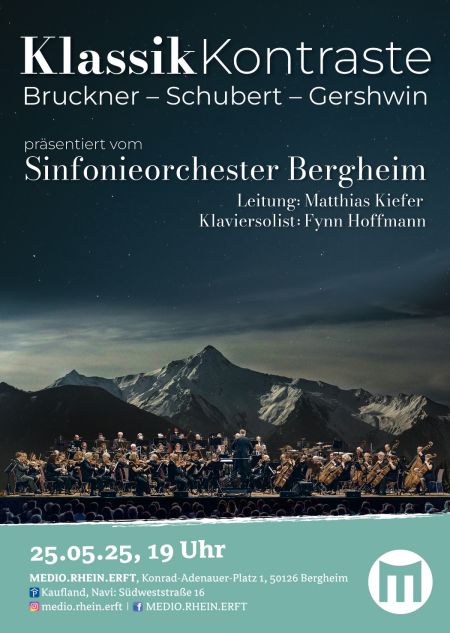Anton Bruckner
Anton Bruckner wurde 1824 in einem Lehrerhaushalt geboren, allerdings in der Provinz, und da war das geistige Klima auch 27 Jahre später noch enger und konservativer als in der Wiener Vorstadt. Dennoch ist es erstaunlich, dass Bruckner seine musikalische „Lehrzeit“ erst mit 39 Jahren beendet hat, ein Alter, das Schubert nie erreichen sollte. Anton bekommt mit 4 Jahren vom Vater eine kleine Geige geschenkt, das ist damals das wichtigste musikalische Utensil für einen künftigen Dorfschullehrer. Er lernt aber auch sehr schnell Klavier und Orgel spielen, sodass er bereits mit 10 Jahren den Gottesdienst begleiten kann.
1837 stirbt der Vater. Das stürzt die Familie in Armut. Der Mutter gelingt es, Anton im nahegelegenen Stift Sankt Florian unterzubringen, wo er eine umfassende, aber natürlich auf Kirchenmusik beschränkte Ausbildung bekommt und eine neue Heimat findet. In der prächtigen Klosterkirche gibt es 3 Orgeln, die größte hat 4 Manuale und 74 klingende Register. Unter ihr wird Bruckner sich später begraben lassen. Auch nach dem Stimmbruch kann er noch ein Jahr als Geiger und Organist bleiben. An der Orgel lernt er ungeahnte Klangwirkungen kennen; er hört sich den Nachhall und die im Kirchenraum entstehenden harmonischen Überlagerungen genau an und kann beim Improvisieren seiner Phantasie freien Lauf lassen. In den Kompositionen, die er nach Bedarf anfertigt, darf man das aber nicht hören. Später sagt er: „Was meine Finger spielen, vergeht, was sie aber schreiben, das bleibt bestehen.“ Vorerst entscheidet er sich für den Lehrerberuf und geht nach Linz auf die Präparandenschule, die er mit Auszeichnung abschließt. In Linz hört er auch zum ersten Mal „weltliche“ Musik, z.B. Beethovens 4. Sinfonie.
Mit 17 tritt er dann seine erste Stelle im kleinen Dorf Windhaag an, das kurz zuvor total abgebrannt war. Hier ist er „niederer Dienstbote“ des Lehrers. Das heißt: um 4 Uhr aufstehen, Kirchendienst, danach Schuldienst, nachmittags Ausmisten und Feldarbeit, am Wochenende in der Kneipe Geige spielen; bei Beerdigungen auch im Winter Choräle spielend mitlaufen. Ärger bekommt er, weil er die Gemeinde mit seinem wilden Orgelspiel durcheinander bringt und zu viel Zeit mit Komponieren verbringt.
So kehrt er 1845 als „systematisierter Schulgehilfe“ und Organist nach St. Florian zurück und macht 1855 die Prüfung für Oberlehrer an Hauptschulen. 1856 wird er Domorganist in Linz, und sammelt dort Dirigier-Erfahrung bei der Liedertafel und städtischen Orchesterkonzerten. Zwischendurch fährt er immer wieder mal nach Wien, um bei Simon Sechter seine Kenntnis der traditionellen Harmonielehre und des Kontrapunkts zu perfektionieren und so viel Musik wie möglich zu hören. Ab 1861 nimmt er dann Unterricht beim 10 Jahre jüngeren Linzer Theater-Kapellmeister Otto Kitzler. Der „brachte den Atem der freien Welt“ (O. Loerke) mit und studierte mit ihm Beethoven-Sonaten und Musik von Mendelssohn bis Meyerbeer. Den Durchbruch bringt aber die Begegnung mit Richard Wagners Musik.
1863 kann Bruckner eine Aufführung des „Tannhäuser“ besuchen, nachdem er die Partitur gründlich studiert hat. Ohne Text, versteht sich, denn das Literarische bleibt ihm zeitlebens fremd. Seine Bücher sind Lehrbücher, die man erst weglegen kann, wenn man alles perfekt beherrscht. Wagner zeigt ihm nun, dass ein großer Künstler Regeln brechen kann und vielleicht sogar muss. Bruckner fühlt sich, „wie ein Kettenhund, der sich von seiner Kette losgerissen hat.“ Mit seinen großen Sinfonien wird er dann viele Hörer und Musikerkollegen begeistern und andere tief verstören. Die Wiener Philharmoniker lehnen seine 2. Sinfonie „als unspielbaren Unsinn“ ab. Er selbst verwirft sogar alles vor 1864 Komponierte als „ganz und gar ungiltig“. So streng wollen wir heute nicht sein!
Seine selten gespielte Ouvertüre in g-Moll von 1863 steht als eins der beiden „Gesellenstücke“ zum Abschluss des gründlichen Studiums irgendwo zwischen den Fronten. Orgelartige Gegenüberstellungen von Klanggruppen, kleine Motive, die sich immer höher schrauben und in entlegene Harmonieregionen führen, und Anwendung aller Tricks der kontrapunktischen Technik findet man hier wie in den späteren Sinfonien. Vor allem aber eine kompromisslose Intensität, der man sich kaum entziehen kann.