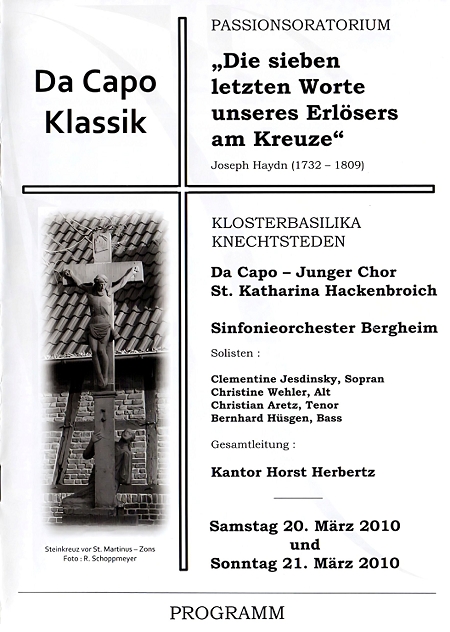Josef Haydn
Im Jahre 1765 erhielt Joseph Haydn aus dem andalusischen Cádiz den Auftrag. für die Karwoche eine Art geistliche Unterhaltungsmusik zu schreiben, in der die „Sieben letzten Worte des Herrn" Ausdeutung erfahren sollten. Haydn schuf „Sieben Sonaten“ mit einer Einleitung mit einem abschließenden Erdbeben für großes Orchester. Diese Reihe gelangte wahrscheinlich am Karfreitag des Jahres 1786 in der unterirdischen Kirche Santa Cueva zur Uraufführung. Ein Jahr später gab Haydn eine Streichquartettfassung der Sonaten heraus, in der vor jeder Nummer die Worte Jesu in lateinischer Sprache abgedruckt waren. Die den Sonaten beigegebenen erklärenden lateinischen Texte stellten nicht nur eine die Stimmung der jeweiligen Nummer umreißende Inhaltsangabe dar, sondern sie hatten ganz offensichtlich die Melodielinie jeder Sonate angeregt, ja sie wurden von Haydn gleichsam „vertont“; die Musik wurde zur „redenden“" Kunst und hatte dementsprechend ganz konkrete Inhalte.
Dies wissend, verfasste nun im Jahre 1792 der Passauer Domherr und Kapellmeister Joseph Friebert zur Orchesterfassung einen passenden Text und brachte das Ergebnis zur Aufführung: Haydn hörte diese Bearbeitung auf seiner zweiten England-Reise und war damit durchaus zufrieden. Wieder in Wien angekommen, legte Haydn diesen Text dann seiner Orchesterfassung zugrunde; lediglich einige Delails wurden von ihm bzw. von Baron van Swieten, der bei der Arbeit assistierte, verändert. Die Textfassung stützt sich bei der Reimbildung und Wortwahl bisweilen etwas aut Christian Fürchtegott Gellerts Geistliche Oden und Lieder, nimmt aber zum Teil auch den „sprachlichen Charakler des Kirchenliedes" an. Van Swieten ließ sich dann noch von Karl W. Ramslers „Tod Jesu“ leiten, dessen Verse 261 - 269 er sogar im Originalwortlaut dem Schlußchor unterlegte. Die „Maestoso Adagio“ vorgeschriebene Einleitung, eine affektgeladene Ouvertüre in der „Requiem-Tonart“ d-Moll führt uns sofort in die tragische Grundatmosphäre des Geschehens ein: scharfe Punktierungen und aufschreiähnliche große Intervalle aber auch „zitternde" Tremoli sowie kühne Modulationen malen die Erregung des Betrachters aus.
Die Nr. 1 erscheint sodann von „Vater"-Anrufen und intensiven Seufzern geprägt, wobei chromatische Führungen für zusätzliche Schmerz Symbolik sorgen; die Nr. 2 bezieht ihr Geschehen weitgehend aus dem Eröffnungs-Anruf, dessen Varianten mannigfaltige Gestalt annehmen, aber auch aus dem Wechspiel zwischen Soli und Chor innere Steigerung erfahren. Pausendurchfurchte, gleichsam atemlose Anrufungen, scharfe Synkopen, dissonante Chromatik und melodisohe Kreuz-Symbolik geben der Nr. 3 ihr unverwechselbares tragisches Kolorit, das in fahles E-Dur (eine Tonart, die bei Haydn immer negativ besetzt ist) getaucht wird. Dann folgt in der Nr. 4 das noch tragischere f-Moll, das die verzweifelte Frage „Warum hast du mich verlassen“ adäquat zu beleuchten weiß. Die Nr. 5 beginnt mit einer „lntroduzione“, deren kunstvolle Polyphonie und Chromatik einen bewussten Gegensatz zum dramatischen Hauptteil darstellt, in welchem Jesus' Ruf „Ach, mich dürstet“ zu entfesselten, harmonisch ungemein geschärften Kommeentaren des Chores führt. Die Nr. 6, „Es ist vollbracht“, mit Ihren schmerzhaften melodischen Aufstiegen, die den Tritonus ausmusizieren und somit auf „Teufel“ und „Sünde" weisen, beginnt in der alten „Todes-Tonart“ g-Moll, ehe die tröstliche Gewissheit, dass Jesus Tod uns die Erlösung bringt, siegt und die Szene in helles G-Dur taucht, ohne die Schmerzsymbolik ganz aufzugeben. Tröstliches Es-Dur, der alte „Ton der Liebe", ist der Nr. 7 mit ihrer gläubigen Zuversicht beigegeben, dann zeichnet ein nahezu realistisch ausgestaltetes „Erdbeben" die Todesstunde des Herrn nach und läßt diese durch ausdrucks- und schmerzvolle Chromatik sowie durch wilde Orchesterschläge noch einmal an unserem Auge vorüberziehen. Mit kühnen Klängen und scharfen Akzenten endet das Werk.